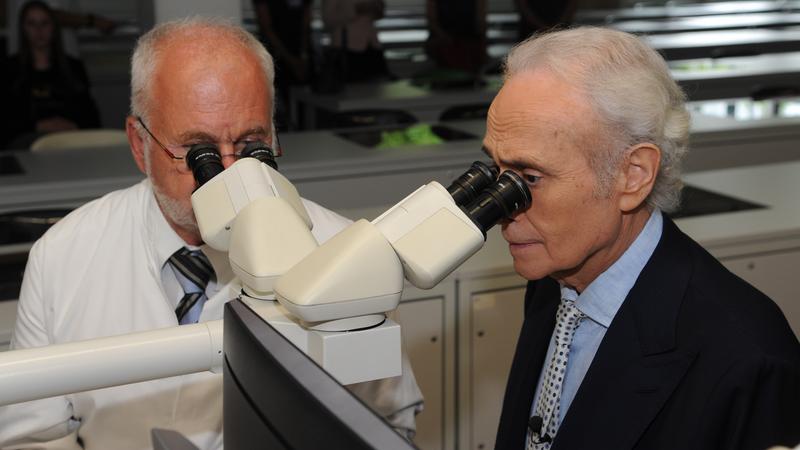José Carreras Leukämie-Stiftung fördert Forschung mit weiteren 4,5 Mio. Euro
Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert neue und zukunftsweisende Forschungsprojekte. Allein in diesem Jahr stellt die José Carreras Leukämie-Stiftung neben der Finanzierung ihrer Basisprogramme weitere 4,5 Millionen Euro für Forschungsprojekte gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zur Verfügung. Unterstützung geht nach Bonn, Dresden, Essen, Heidelberg, Kiel, Köln, Leipzig, Mainz Mannheim, Marburg, München, Münster, Tübingen und Würzburg
Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert deshalb neue und zukunftsweisende Forschungsprojekte. „Allein in diesem Jahr stellt die José Carreras Leukämie-Stiftung neben der Finanzierung ihrer Basisprogramme weitere 4,5 Millionen Euro für Forschungsprojekte gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zur Verfügung. Unser Ziel ist es, das Leid aller Patienten zu lindern und Hoffnung auf Heilung zu schenken. Dafür braucht es neue Erkenntnisse durch Forschung. Mit den aktuellen Forschungsprojekten hoffen wir hier neue Maßstäbe setzen zu können“, erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung.
Alle Förderanträge wurden vor der Zusage vom Wissenschaftlichen Beirat der José Carreras Leukämie-Stiftung eingehend nach dem Peer-Review-Verfahren geprüft. Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus renommierten Medizinern, die sich einen Namen in der hämato-onkologischen -Forschung gemacht haben, sowie aus Dr. Gabriele Kröner.
Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem:
Mannheim: Dr. Mohamad Jawhar und Dr. Nicole Naumann, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, III. Medizinische Universitätsklinik (Onkologie/Hämatologie)
Forschungsthema: Genetische und klinische Heterogenität der fortgeschrittenen systemischen Mastozytose
Erklärung: Die fortgeschrittene systemische Mastozytose ist eine seltene Erkrankung der blutbildenden Zellen im Knochenmark. Werden Organe wie die Leber oder die Milz von den sogenannten „Mastzellen“ infiltriert, können irreparable Schäden an dem betreffenden Organ die Folge sein, die innerhalb kurzer Zeit zum Tod führen können. Das Projekt soll spezifische Charakteristiken auf Ebene des Erbmaterials betroffener Patienten identifizieren um einzelne Erscheinungsformen der Erkrankung besser unterscheiden und therapieren zu können.
Würzburg: Prof. Ralf C. Bargou und Dr. Kurt Bommert, Universitätsklinikum der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Comprehensive Cancer Center Mainfranken
Forschungsthema: Evaluation von HECT E3 Ligasen als potentielle therapeutische Zielstrukturen im Multiplen Myelom
Erklärung: Das Multiple Myelom ist eine bisher unheilbare maligne Erkrankung der Antikörper produzierenden Plasmazellen. Die Myelomzellen sind vorwiegend im Knochenmark lokalisiert, verdrängen die normale Blutbildung und führen zu Knochen-abbau. Inhibitoren des Proteasomsystems sind inzwischen ein wichtiger Therapiebestandteil. Im Rahmen dieses Projektes soll eine Gruppe von Proteinen des Ubiquitin/Proteasomsystems (die HECT-E3 Ubiquitinligasen) auf ihre therapeutische Eignung beim Multiplen Myelom charakterisiert werden.
Dresden und Leipzig: Prof. Uwe Platzbecker, Medizinische Klinik und Poliklinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und Institut für Biofunktionelle Polymermaterialien, Leibniz-Institut für Polymerforschung e.V., Dresden und Universitätsklinikum Leipzig, Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie
Forschungsthema: Funktionelle Charakterisierung extrazellulärer Matrix von MDS
Erklärung: Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind heterogene klonale Erkrankungen, die aus frühen hämatopoetischen Stammzellen (HSC) entstehen. Ziel des Projekts ist die strukturierte Analyse der Zusammensetzung der ECM von MDS-Patienten im Vergleich zu ECM gesunder Probanden ähnlichen Alters mit verschiedenen Mikroskopie- und proteinbiochemischen Methoden. Des Weiteren soll der Einfluss von MDS ECM auf die Eigenschaften und Funktion der HSC mit zellbiologischen Methoden und Kolonie Assays getestet werden. Mit diesem Projekt wird erhofft, neue Erkenntnisse über den Beitrag der ECM zur Entstehung und dem Verlauf der MDS zu gewinnen, was zukünftige diagnostische Anwendungen und Vorhersagen zum Behandlungserfolg unterstützen könnte.
Mainz: Dr. Borhane Guezguez, Deutsches Krebsforschungszentrum, Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK), Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, III. Medizinische Klinik und Poliklinik, Abteilung für Hämatologie, internistische Onkologie und Pneumologie
Forschungsthema: Entschlüsselung epigenetischer und metabolischer Determinanten der Erklärung: MDS-AML-Progression zur Entwicklung neuer zielgerichteter Therapiestrategien
Das Forschungsprojekt wird untersuchen, wie MDS-Krebsstammzellen zum Fortschreiten der Krankheit zu Leukämie beitragen. Es wurde bereits ein einzigartiges MDS-Mausmodell entwickelt, mit dem sich der Krankheitsverlauf nachvollziehen lässt. Dieses Mausmodell wird verwendet, um MDS-Krebsstammzellen zu isolieren und sie in Kultur anzubauen. Sobald die spezifischen molekularen und genetischen Defekte in diesen Zellen identifiziert sind, werden therapeutische Mittel untersucht, die spezifisch die resistenten Zellen anzielen und abtöten. Das Forschungsprojekt unterstützt die Entwicklung neuer Therapien für MDS, die hoffentlich in klinischen Studien zur erfolgreichen Bekämpfung von MDS-Krebsstammzellen getestet werden.
Kiel: Prof. Claudia Dorothea Baldus, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Innere Medizin II, Hämatologie und Onkologie
Forschungsthema: Onkogen-Aktivierung durch IDH Mutationen in der akuten myeloischen Leukämie
Die genetische Charakterisierung hat unmittelbare Konsequenzen für die Behandlung von Patienten mit akuten Leukämien: so konnten zuletzt neue zielgerichtete Medikamente (FLT3 und IDH Inhibitoren) für die Behandlung der AML zugelassen werden. IDH Mutationen können zu einer Aktivierung von Genen führen, die Erkrankungen besonders antreiben (Onkogene). In diesem Projekt sollen nun Regulationsmechanismus und die Aktivierung von IDH abhängigen Onkogenen untersucht werden, um neue Einblicke der Erkrankung offen zu legen.
Münster: Prof. Karl-Heinz Klempnauer, Universität Münster, Institut für Biochemie
Forschungsthema: Entwicklung niedermolekularer Inhibitoren des Transkriptionsfaktors C/EBPβ (Development of small molecule inhibitors of the transcription factor C/EBPβ)
Erklärung: Die Entstehung von Leukämien ist eng mit Defekten der Funktion sogenannter Transkriptions-faktoren verknüpft, die die Genaktivität und damit vielenzellulären Prozessen steuern. Vorarbeiten haben zu der Hypothese geführt, dass der Transkriptionsfaktor C/EBPβ bei der akuten myeloischen Leukämie eine wichtige Rolle spielt. In diesem Projekt sollen potentielle Inhibitoren für C/EBPβ identifiziert und ihre Wirkung auf Leukämiezellen untersucht werden.
Heidelberg: PD Dr. Michael Hundemer, Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Klinik V
Forschungsthema: The Immunmodulatory Impact of IKZF3 Expression on T-cells in Patients with Multiple Myeloma
Erklärung: Bei der Behandlung von Patienten mit Multiplen Myelom, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks, spielt die Aktivierung des Immunsystems des Patienten gegen den Tumor eine zunehmende Rolle. In dem Projekt soll der Einfluss des aktivierenden Proteins IKZF3 auf das Immunsystem von Patienten mit Multiplen Myelom untersucht werden, um zukünftig T-Zellen gezielt gegen Tumorzellen zu aktivieren.
Marburg: PD Dr. Oleg Timofeev und Prof. Thorsten Stiewe, Philipps-Universität Marburg, Institut für Molekulare Onkologie, ZTI
Forschungsthema: Therapie von akuten myeloischen Leukämien mit TP53 non-hotspot Mutationen
Erklärung: Leukämiepatienten sprechen auf Standardtherapien nur noch schlecht an, wenn sie Veränderungen im p53-Gen aufweisen. In den letzten Jahren wurden einige neue Therapien speziell für solche Patienten entwickelt. Da das p53-Gen auf viele verschiedene Arten verändert sein kann, soll in diesem Projekt untersucht werden, welche molekulare Therapiestrategie bei welcher Art von p53-Veränderung die besten Erfolge erzielt.
Köln: Dr. Lukas Frenzel und Prof. Christian Reinhardt, Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin
Forschungsthema: Targeting resistance against venetoclax in high risk CLL
Erklärung: Die ersten klinischen Daten in der CLL, aber auch anderen hämatologischen Neoplasien mit Venetoclax sind sehr vielversprechend, doch ist der klinische Verlauf nach Entwicklung einer Resistenz mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet. Daher soll durch dieses Projekt verstanden werden, welche Rolle bestimme genetische Veränderung in der Vermittlung der Resistenz spielen und wie diese medikamentös überwunden werden können.
Tübingen: Prof. Julia Skokova und Dr. Baubak Bajoghli, Universitätsklinikum Tübingen, Medizinische Klinik II
Forschungsthema: Development of new therapeutic tools to prevent or treat leukemia in congenital neutropenia patients using drug screening in vitro in iPSCs and in vivo in zebrafish
Erklärung: Schwere angeborene Neutropenie ist eine erhebliche Bluterkrankung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit (ca. 20%), eine akute myeloische Leukämie zu entwickeln. Mit Hilfe von CRISPR/Cas9 Gene Editierung in induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) von Patienten wurde ein Modell der Leukämie-Entwicklung etabliert. Nun wird geplant, dieses Modell für die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien zu verwenden, um die Leukämie zu verhindern bzw. zu behandeln.
Köln: Prof. Michael Hallek, Universitätsklinikum Köln, Klinik Innere Medizin I und CECAD Research Center
Forschungsthema: Bedeutung des Adhäsionsmoleküls CD44 für die Pathogenese der chronisch lymphatischen Leukämie
Erklärung: In diesem Projekt wird die Bedeutung von CD44 für die leukämische Entwicklung der CLL untersucht. Insgesamt ermöglicht es dieses Projekt ein besseres Verständnis der funktionellen Interaktionen von MIF und CD44 sowohl bei der CLL, aber auch bei anderen Krebsentitäten. Die Befunde haben Relevanz für eine gegen CD44 gerichtete anti-leukämische Therapie.
Heidelberg: Dr. Martina Seiffert, Deutsches Krebsforschungszentrum, Abteilung Molekulare Genetik
Forschungsthema: Primäre und induzierte Resistenz gegen Immun-Checkpoint-Inhibitoren bei der chronischen lymphatischen Leukämie
Erklärung: Die Aktivierung der eigenen Immunabwehr gegen Tumore ist ein vielversprechender Therapieansatz bei Krebs, der jedoch nur bei einem Teil der Patienten erfolgreich ist. Das Projekt hat zum Ziel, bei chronischer lymphatischer Leukämie molekulare Mechanismen zu identifizieren, die für Ansprechen oder Resistenzentwicklung gegen diesen Therapieansatz verantwortlich sind, um die Heilungschancen der Patienten zu erhöhen.
München: Prof. Katharina Götze, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Medizinische Klinik und Poliklinik III, Hämatologie/Onkologie
Forschungsthema: Neue therapeutische Ansätze bei myelodysplastischen Syndromen durch Analyse epigenetischer Veränderungen in der Knochenmarksnische
Erklärung: Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind Erkrankungen der blutbildenden Stammzellen im Knochenmark. Genetische Veränderungen der Stammzelle führen dazu, dass die gebildeten Blutzellen nicht mehr korrekt ausreifen und nicht funktionstüchtig sind. Das Gleichgewicht zwischen Vermehrung und Differenzierung von Stammzellen wird stark von deren Umgebung, der sogenannten Knochenmarksnische, beeinflusst. Es wird untersucht, wie die Veränderungen in der Nische hervorgerufen werden. Da Nischenzellen nicht primär genetisch verändert sind, sollte diese Veränderungen umkehrbar sein. Somit wird ganz besonders Ziel sein zu verstehen, wie man therapeutisch Eingreifen könnte, um die Nischenzellen wieder in den Zustand zu versetzen, in dem sie gesunde Stammzellen und nicht die erkrankten fördern. Da ähnliche Veränderungen der Nische auch bei anderen Leukämien eine zentrale Rolle spielen, wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse auch für diese Erkrankungen hilfreich sein werden.
Leipzig: M.Sc. Peter Esser und Prof. Anja Mehnert, Universitätsklinikum Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie Universitätsklinikum, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I
Forschungsthema: Trauma- und belastungsbezogene Störungen bei hämatologischen Krebspatienten nach Stammzelltransplantation: Eine Interview-basierte Studie anhand aktualisierter diagnostischer Kriterien
Erklärung: Trotz der hohen Belastung einer Stammzelltransplantation (SZT) ist die Studienlage zu belastungsbezogenen Störungen in dieser Patientengruppe gering. Diese Studie wird Daten zu hämatologischen Krebspatienten mit und ohne SZT hinsichtlich trauma- und belastungsbezogener Symptomatik erheben, wodurch Ausmaß sowie entsprechende Risikofaktoren identifiziert werden können. Vergleiche von SZT-Patienten mit (i) Patienten ohne SZT sowie der (ii) Allgemeinbevölkerung werden Fragen der besonderen Behandlungsbedürftigkeit von SZT-Patienten beantworten.
Bonn: Prof. Dominik Wolf, Universitätsklinik Bonn, Medizinische Klinik III, Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie
Forschungsthema: Die Rolle von NK-Zellen in der Krankheitsbiologie und Therapie Philadelphia-negativer Myeloproliverativer Neoplasien (MPN)
Erklärung: Myeloproliferative Neoplasien (MPN) sind chronische Erkrankungen des Knochenmarks, die durch ein „zu viel“ an verschiedenen Blutzellen charakterisiert sind. Einige MPN-Typen sind durch eine sehr starke Entzündungsreaktion charakterisiert, wodurch Symptome erklärbar sind, aber auch eine Schwäche der angeborenen und der erworbenen Immunantwort. Natürliche Killer (NK) Zellen sind ein zentrales Element der angeborenen Immunantwort und sehr wichtig für den Schutz des Körpers gegen Virusinfektionen und vor der Entstehung von Krebs. Das Projekt untersucht die Bedeutung und Funktion von NK Zellen in MPN bei Mensch und in Tiermodellen. Dies wird helfen die immunologische Fehlfunktion, Infektanfälligkeit und auch die Biologie der MPNs besser zu verstehen und neue Therapieansätze dieser Knochenmarks-Erkrankung zu entwickeln.
Essen: PD Dr. Cyrus Khandanpour, Universitätsklinikum Essen, Klinik für Hämatologie
Forschungsthema: Mesenchymale Stammzellen als Ansatz der AML-Therapie
Trotz zahlreicher neuer Erkenntnisse der Ursachen der akuten myeloischen Leukämie (AML), einer bösartigen Erkrankung des Blutes, bleibt die Prognose der davon betroffenen Patienten schlecht. AML-Zellen residieren vor allem im Knochenmark und sind dort von einer Vielzahl von Zellen wie Gefäßzellen, Knochenzellen, mesenchymalem Stammzellen und Bindegewebszellen umgeben. Erste Hinweise darauf, dass einige dieser Zellen, genannt mesenchymale Stammzellen (MSC), durch die AML-Zellen dahingehend beeinflusst werden, dass diese das Wachstum der leukämischen Zellen fördern. Es wird untersucht, ob und wie AML-Zellen Veränderungen im Erbgut der MSCs bewirken. Weiterhin soll untersucht werden, ob durch Infusion von gesunden MSCs Patienten vor einen Rückfall der Leukämie bewahrt werden können.
Leipzig: Prof. Gerhard Behre, Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Department für Innere Medizin, Abteilung für Hämatologie und Onkologie Forschungsthema: Systembiologie von onkogenen miRNAs in der akuten myeloischen Leukämie mit CEBPA Mutationen
Erklärung: C/EBPalpha ist ein wichtiger Transkriptionsfaktor bei der Differenzierung von hämatopoetischen Stammzellen zu Granulozyten und funktionell beeinträchtigt bei vielen Formen der akuten myeloischen Leukämie (AML). MicroRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die die Genexpression regulieren. C/EBPalpha kann bei der AML sowohl microRNAs induzieren (Tumorsuppressoren) als auch reprimieren (Onkogene). In diesem Projekt soll ein Netzwerk aus microRNAs identifiziert werden, das wichtig ist für die Entwicklung von AML, die durch C/EBPalpha-Mutationen gekennzeichnet ist, und dass man therapeutisch beeinflussen kann, um die Therapie der AML mit C/EBPalpha-Mutationen zu verbessern.
Weitere Informationen:
https://www.carreras-stiftung.de/2018/11/08/jose-carreras-leukaemie-stiftung-foerdert-forschung-mit-weiteren-45-mio-euro/
Ähnliche Pressemitteilungen im idw