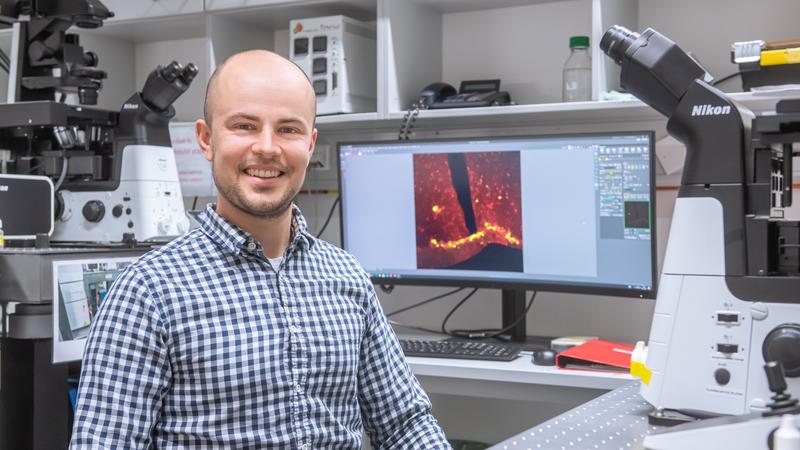Welche Rolle spielt das Bindungshormon Oxytocin bei seltenen Entwicklungsstörungen?
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert neue Emmy Noether-Nachwuchsgruppe am Universitätsklinikum Heidelberg sechs Jahre lang mit insgesamt rund 2,1 Millionen Euro / Neurowissenschaftler Dr. Ferdinand Althammer vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Heidelberg untersucht Mechanismen gestörter Signalgebung im Gehirn bei Prader-Willi- und Schaaf-Yang-Syndromen
Wie Verhaltensauffälligkeiten bei zwei seltenen Entwicklungsstörungen mit einem Mangel des Bindungshormons Oxytocin im Gehirn zusammenhängen, ist Forschungsthema einer neuen Emmy Noether-Nachwuchsgruppe am Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD). Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Team von Neurowissenschaftler Dr. Ferdinand Althammer in den kommenden sechs Jahren mit insgesamt 2,1 Millionen Euro. Kinder mit den angeborenen Entwicklungsstörungen „Prader-Willi-Syndrom“ und „Schaaf-Yang-Syndrom“ leiden an einer Reihe von geistigen und körperlichen Symptomen. Dazu gehören häufig eine Autismus-Spektrum-Störung mit Verhaltensauffälligkeiten und beeinträchtigter sozialer Interaktion. Die Aufklärung der zugrundeliegenden Mechanismen ist Voraussetzung für die Entwicklung von Therapien, um Symptome lindern zu können.
Das Emmy Noether-Programm der DFG ermöglicht hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sich durch Leitung einer Forschungsgruppe für eine Hochschulprofessur zu qualifizieren.
Im Genom von Menschen mit dem sogenannten Prader-Willi-Syndrom (PWS) fehlt ein Abschnitt mit den Bauplänen für mehrere Proteine. Betroffene Kinder leiden unter Muskelschwäche, haben ständig Hunger und nehmen schnell zu. Ihre körperliche und geistige Entwicklung ist beeinträchtigt. Mit ähnlichen Symptomen geht das Schaaf-Yang-Syndrom (SYS) einher, das nach seinen Erstbeschreibern Prof. Dr. Christian Schaaf, Direktor des Instituts für Humangenetik am UKHD, und Prof. Dr. Yaping Yang vom Baylor College of Medicine in Houston, USA, benannt ist. Obwohl beim SYS nur eines dieser Gene, das Gen „MAGEL2“ verändert ist, und in Folge das darauf codierte Protein in einer funktionslosen Form gebildet wird, sind die Symptome im Durchschnitt schwerer als beim PWS. Weltweit gibt es rund 300.000 bis 400.000 PWS-Betroffene, beim SYS wurden bisher rund 300 Familien entdeckt.
Mäuse mit vergleichbaren genetischen Veränderungen zeigen Verhaltensauffälligkeiten, die denen von menschlichen Betroffenen ähneln: Sie haben wenig Interesse an Umwelt und Artgenossen, ihr Sozialverhalten ist beeinträchtigt und sie sind vermindert lernfähig. „Einige der Defizite in Sozialverhalten und Lernfähigkeit konnten bei den Mäusen durch die tägliche Gabe des Hormons Oxytocins abgemildert werden“, erläutert Dr. Ferdinand Althammer. „Gleichzeitig ist bei ihnen die Oxytocin-Bildung im Gehirn verringert. Das macht die Prozesse rund um dieses Hormon, von der Bildung über die Aktivierung spezieller Nervenzellen und deren Vernetzung bis zu Störungen in der Signalweiterleitung, zu einem möglichen Ansatzpunkt für neue Therapien. Ziel meiner Forschungsgruppe wird es sein, die Auswirkungen dieser Gendefekte auf die Abläufe im Gehirn und die daraus folgenden Verhaltensauffälligkeiten aufzuklären.“
Obwohl beide Syndrome genetisch bedingt und derzeit nicht heilbar sind, könnten die Ergebnisse relevant für die betroffenen Familien sein. Hinweise darauf gab 2017 eine Studie der Universität Toulouse, bei der Säuglinge mit PWS über ein Nasenspray täglich Oxytocin erhielten. Bei der Mehrheit der Kinder (88 Prozent) normalisierte sich daraufhin das Saugverhalten. Die Behandlung wird derzeit in einer größeren Phase-III-Studie wiederholt. „Diese Ergebnisse wecken Hoffnung, dass auch weitere Symptome mit den Mechanismen rund um Oxytocin zusammenhängen und möglicherweise gelindert werden könnten“, so Dr. Althammer.
Die neue Emmy-Noether-Gruppe am Institut für Humangenetik des UKHD wird verschiedene Methoden kombinieren, um die Verfügbarkeit und Wirkung von Oxytocin im Gehirn von Mäusen und Menschen unter die Lupe zu nehmen: Mit Hilfe von speziellen Färbemethoden und Bildgebungsverfahren (Clearmap) werden die Wissenschaftler unter anderem die neuronale Aktivität im Gehirn von Mäusen mit den entsprechende Defekten nach sozialen Interaktionen unter die Lupe nehmen. Ziel ist es herauszufinden, wie die Oxytocin-produzierenden Zellen im Gehirn vernetzt sind, ob ihre Anzahl verändert ist, wie stark sie durch Sozialkontakte aktiviert werden, ob die Aktivierung der nachgeschalteten Nervenzellen noch funktioniert, wie genau sich die Strukturen und Aktivitätslevel im Vergleich zu gesunden Mäusen unterscheiden und ob sich mögliche Störungen pharmakologisch oder gentechnisch ausgleichen lassen. In einem translationalen Ansatz sollen die Ergebnisse aus den Mausgehirnen zudem mit der Situation in menschlichen Zellen Betroffener abgeglichen werden.
Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Dr. Ferdinand Althammer, PhD
Institut für Humangenetik am UKHD
E-Mail: ferdinand.althammer@med.uni-heidelberg.de
Weitere Informationen:
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/humangenetik
Ähnliche Pressemitteilungen im idw